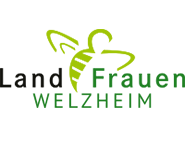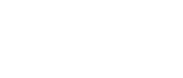Das Thema guter Schlaf und Schlafstörungen beschäftigt mehr Menschen als gedacht. 50 Teilnehmer/innen haben sich für diesen Vortrag interessiert.
Die Referentin Dorothea Endreß ist medizinische Fachangestellte mit einer Fortbildung zur Naturheilkundeberaterin.
Sie sprach zunächst über die Ursachen für Schlafstörungen, beginnend mit medizinischen Problemen wie Instabilität der Wirbelsäure, orthopädische Schäden, Schmerzen, Restless-Leg-Syndrom, Schlafapnoe, nächtlicher Harndrang, Hitzewallungen, Zähneknirschen usw. Weiter ging sie auf äußere Einflüsse im Lebensumfeld ein: Schichtarbeit, Lärm, Lichtverschmutzung, Stress, persönliche Probleme, Alkohol, spätes oder schweres Essen usw.
Die Referentin machte deutlich, dass der erste und wichtigste Schritt zu gesundem Schlaf die Suche nach der Ursache der Schlafstörung ist. Sie wies darauf hin, in welchen Fällen eine medizinische Abklärung der Probleme wichtig sind. Sie zeigte viele Möglichkeiten auf, damit umzugehen. Zum einen wurde eine Änderung der Gewohnheiten thematisiert, wie leben im eigenen Rhythmus (Eule, Lerche), abends leicht essen, vor dem ins Bett gehen nicht mehr in den Fernseher, auf den Computer oder das Mobiltelefon schauen, usw. Zum anderen zeigte sie sanfte Methoden der Entspannung auf wie Aromatherapie, Bachblüten, Entspannungsmusik, Melatonin-Kapseln, Schüssler-Salze, Tees, Wärmflasche, Wollauflage auf Matratze, Zirbenkissen, usw. Sie sprach auch über die Macht der Sprache: wer ein Problem im Leben nicht als großes Problem sieht, sondern als Herausforderung, die es zu meistern gilt, kommt eher zur Ruhe.
Wer erwartet hatte, ein Generalrezept für guten Schlaf zu erhalten, wurde sicherlich enttäuscht. Fazit: Im Vortrag wurden viele Ursachen und Möglichkeiten der Abhilfe thematisiert. Letztendlich ist jede Person anders und muss selbst ausprobieren, welcher Weg für sie zu einem gesunden Schlaf führt. An Anregungen hierzu mangelte es in dem Vortrag nicht.